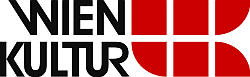Ist Musik nützlich, oder noch viel mehr? Im Rahmen des mica focus machen wir uns in der folgenden Reihe Gedanken zu Musik und Bildung. Wir haben den Neurobiologen Konrad Lehmann nach dem biologischen Imperativ der Musik gefragt. Unser Autor betont die soziale Komponente der Musik: “Ihr Ursprung ist die Gemeinschaft, nicht das Gegeneinander. Menschen machen Musik – und Menschenaffen nicht -, weil Menschen altruistisch denken können – und Menschenaffen nicht.”
Menschen machen Musik. Dieser Satz ist nicht nur eine triviale Beobachtung: Er ist fast so etwas wie eine Definition. In allen Kulturen der Welt gibt es Musik. Sogar die Tsimane machen Musik: Dieses bolivianische Amazonasvolk, das bislang ohne Kontakt zu westlicher Musik geblieben ist, kennt keine Harmonik, keine Polyphonie, keinen Gruppengesang. Die Tsimane machen daher auch keinen Unterschied zwischen dissonanten und konsonanten Harmonien (McDermott et al. 2016). Ob Tritonus oder reine Quinte: Es ist alles gleichermaßen mittelmäßig angenehm. Abendländischen Musikvorstellungen könnten sie nicht ferner sein. Aber selbstverständlich machen sie Musik.
Was im Raum gilt, gilt auch in der Zeit: Menschen machen Musik. Immer schon. Die ältesten gefunden Musikinstrumente in Europa – Knochen- und Elfenbeinflöten auf der Schwäbischen Alb – sind ungefähr so alt wie die Anwesenheit von Homo sapiens in Europa, nämlich zwischen 35000 und 40000 Jahren (Conard et al. 2009), Die Musikerin Gabriele Dalferth hat Stücke auf getreulichen Nachbauten eingespielt, die auch für moderne Ohren wohltuend klingt.
Musik gehört zum Menschsein
Musik scheint also zum Menschsein zu gehören. Wie die Sprache, mit der sie offensichtliche Gemeinsamkeiten teilt, unterscheidet sie den Menschen von seinen nächsten Verwandten. Affen, auch Menschenaffen, sind vollständig unmusikalisch. Wenn man Schimpansen einmal beim Trommeln erwischt, wird das gleich hochrangig wissenschaftlich publiziert (Dufour et al. 2015). Denn normalerweise fällt es ihnen schon schwer, einem Beat zu folgen. Nachdem Terry Pratchett vorgeschlagen hat, Homo sapiens umzutaufen in Pan narrans (der erzählende Schimpanse), wäre ein ebenso gerechtfertigter Vorschlag „Pan cantans“ (der singende Schimpanse).
Warum ist Musik für Menschen so wichtig? Befragt, warum Menschen in der Steinzeit Musik gemacht hätten, antwortete der Ausgräber der Flöten, Nicholas Conard, im Interview knapp und überzeugend: „Weil Musik schön ist.“ Aber warum ist sie das – für Menschen?
Ein Klangbeispiel der von Nicholas Conard entdeckten Flöte. Quelle und weitere Informationen auf der Website des National Public Radio: www.npr.org/…/…storyId=105823127
Dopamin im Nucleus accumbens
Gehirnforscher haben in den letzten Jahren gezeigt, dass der Nucleus accumbens, das Belohnungszentrum unseres Gehirns, aktiviert wird, wenn wir Musik hören, die uns gefällt. Angeregt durch den Botenstoff Dopamin, regt sich der Nucleus accumbens normalerweise, wenn es handfeste Belohnungen gibt: Futter, Sozialkontakt, Drogen. Was aber hat ihm Musik zu bieten?
Ob Dopamin im Nucleus accumbens ausgeschüttet werden soll, entscheidet dieser natürlich nicht aus sich selbst heraus. Die Abwägung, was man erwarten darf, trifft ein Teil des Stirnhirns, nämlich jener, der unmittelbar über den Augen aufliegt. Auch hier fanden die Forscher Aktivität. Die Schlüsselrolle aber haben etwas seitlich darüber liegende Teile des Stirnhirns inne: Sie stehen in enger Verbindung zur Hörrinde, sie bieten das Arbeitsgedächtnis, das nötig ist, um den Ablauf der Musik in der Zeit verfolgen und strukturieren zu können, sie erkennen auf dieser Grundlage Regelmäßigkeiten, und geben die Information schließlich an das untere Stirnhirn weiter. Vorwiegend geschieht dies in der rechten Hemisphäre, wo die eher subtilen und weitreichenden Muster erfasst werden. Dies wird bestätigt durch Forschung an Menschen, die Musik nicht genießen können, weil sie Tonhöhen nicht unterscheiden können, also Patienten mit Amusie: Überraschenderweise ist die Funktion der Hörrinde bei ihnen völlig intakt. Gestört ist ihre Verbindung ins rechte Stirnhirn, oder dieses selbst.
Eine erste Antwort auf die Frage, warum Menschen Musik mögen, lautet also einfach: Weil wir eine besondere Verbindung zwischen unserer Hörrinde und unserem Stirnhirn haben, die es uns erlaubt, melodische Strukturen zu erkennen, und aus diesem Erkennen Vorhersagen zu generieren, deren Erfüllung oder Übererfüllung Genuss bereitet.
Amusie hat genetische Ursachen
Aber warum haben wir Menschen (normalerweise) diese besondere Verbindung? Vieles spricht dafür, dass sie mit einer weiteren Eigenschaft zusammenhängt, die uns von Menschenaffen unterscheidet: unserer Fähigkeit zur sozialen Empathie, zur gleichberechtigten Kooperation.
Musik beruht auf, ja, besteht aus sozialen Signalen. Bei verschiedenen Suchen nach musikalischen Universalien unter den Kulturen der Welt kam recht wenig Allgemeingültiges heraus, bis auf dies: In den meisten Kulturen wird Musik gemeinsam aufgeführt (Savage et al. 2015). Musik hat soziale Funktionen, und zwar in ihren beiden wichtigsten Komponenten: Melodik und Rhythmik.
In den Tonhöhen, in der Melodik also, drücken sich Gefühle aus. Wissenschaftler spielten Probanden verschiedene Intervalle vor und untersuchten zugleich die Frequenzspektren von Wörtern, die mit unterschiedlichen Gefühlen ausgesprochen wurden (Curtis & Bharrucha 2010). Beide Herangehensweisen kamen zu demselben Ergebnis: Die absteigende kleine Terz ist das Intervall der Traurigkeit. Die Kombination von aufsteigender kleiner Sekunde, gefolgt von der reinen Quinte (zwischen den beiden also der Tritonus) drückt Wut aus. Dass Intervalle Gefühle verraten, zeigt sich auch darin, dass amusische Menschen die Prosodie nicht aus der Sprachmelodie erkennen können (Lolli et al. 2015). Und Amusie ist genetisch veranlagt (Peretz 2006), das heißt: Musik ist uns angeboren.
Auch amusische Menschen kennen das Metrum
Über die zweite soziale Komponente von Musik verfügen sogar Amusiker: das Metrum. Einem gemeinsamen Takt zu folgen, ist eine soziale Leistung. Denn zum Mitklopfen muss man das Signal eines Anderen antizipieren. Gemeinsames Klatschen, Headbangen, Schunkeln erzeugt soziale Resonanz. Im Tierreich findet man diese Fähigkeit erstaunlicherweise bei denjenigen Gruppen, die ihre Lautäußerungen durch Nachahmung lernen: bei Singvögeln, Papageien und Meeressäugern (Patel 2014). Menschenaffen hingegen schaffen es noch nicht einmal dann, wenn man sie monatelang darauf trainiert. Ganz davon zu schweigen, einen Tempowechsel mitzumachen. Faszinierende Forschungsarbeiten des Leipziger Primatenforschers Michael Tomasello haben in den letzten Jahren demonstriert, dass unsere nächsten äffischen Verwandten sich auch, salopp gesagt, einen feuchten Dreck darum scheren, was andere von ihnen denken. Altruismus, soziale Intelligenz, Gemeinsinn: Fehlanzeige.
Der verwertbare Nutzen der Musik
Das bedeutet: Wenn es um den Wert der Musik geht, wird oft danach gefragt, ob sie einen verwertbaren Nutzen bringt. Macht sie intelligenter, konzentrierter, kreativer? Mit einem Wort: konkurrenzstärker? Gibt es den „Mozart-Effekt“, der bei Beschallung mit Musik des Wiener Meisters Schüler besser denken und Kühe besser Milch geben lässt?
Jüngere Forschung zeigt: Es gibt ihn nicht.
Und darüber sollte man froh sein. Musik lässt sich nicht instrumentalisieren, um das Humankapital (oder, im Falle der Kühe Bovinkapital) zu verbessern. Ihr Ursprung ist die Gemeinschaft, nicht das Gegeneinander. Menschen machen Musik – und Menschenaffen nicht -, weil Menschen altruistisch denken können – und Menschenaffen nicht. Musik ist beim Menschen (und faszinierenderweise auch bei einigen Vögeln und Meeressäugern) Ausdruck und Mittel der sozialen Übereinstimmung.
Und außerdem ist sie, wie Conard sagt, einfach schön. Musik ist ein Wert an sich, eine der höchsten Erscheinungsformen unseres Mensch-Seins.
Literaturverweise
Conard, M.J., Malina, M. & Münzel, S.C. (2009) New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany. Nature 460: 737-740. Das Abstract auf Nature, hier geht es zurück zum Text ↑
Curtis, M.E. & Bharucha, J.J. (2010) The minor third communicates sadness in speech, mirroring its use in music. Emotion 10: 335-348. Der Volltext auf Openscholar, hier geht es zurück zum Text ↑
Dufour, V., Poulin, N., Curé, C. & Sterck, E.H.M. (2015) Chimpanzee drumming: a spontaneous performance with characteristics of human musical drumming. Sci. Rep. 5:11320. Der Volltext auf NCBI, hier geht es zurück zum Text ↑
Lolli, S.L., Lewenstein, A.D., Basurto, J., Winnik, S. & Luoi, P. (2015) Sound frequency affects speech emotion perception: results from congenital amusia. Front. Psychol. 6: 1340.Der Volltext auf NCBI, hier geht es zurück zum Text ↑
McDermott, J.H., Schultz, A.F., Undurraga, E.A. & Godoy, R.A. (2016) Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. Nature 535: 547-550.Das Abstract auf Nature, hier geht es zurück zum Text ↑
Patel, A.D. (2014) The evolutionary biology of musical rhythm: Was Darwin wrong? PLOS Biology 12: e1001821. Der Volltext auf Plos, hier geht es zurück zum Text ↑
Peretz, I. (2006) The nature of music from a biological perspective. Cognition 100: 1-32. Der Volltext als pdf auf der Seite des Dartmouth Colleges, hier geht es zurück zum Text ↑
Danke
Dieser Beitrag wurde von der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) gefördert.