Wie haben sich die Hörgewohnheiten vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung geändert? Welche Schlüsse lassen sich daraus für Musiksoziologie und -pädagogik ziehen? Eine Diskussionsveranstaltung versuchte, sich diesen Fragen zu nähern.
Michael Hubers brandaktuelles Buch „Musikhören im Zeitalter Web 2.0“, das dieser Tage bei „Springer VS“ erscheint und von Peter Tschmuck bereits als „Pionierarbeit zum Verständnis der Musikrezeption in Österreich“ bezeichnet wurde, bildete den Anlass für eine Podiumsdiskussion zum Thema an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Mit den veränderten Rahmenbedingungen des Musikhörens ließen sich vor allem bei Jugendlichen neue Verhaltensweisen beobachten, die sich von der Hörpraxis der Vor-Internetzeit grundlegend unterscheiden, so der Autor, Professor am Institut für Musiksoziologie der mdw. Aber wie sollen Kulturpolitik, Musikvermittlung und Musikpädagogik darauf reagieren? Diesen Fragen stellten sich unter der Leitung von Michael Huber Wilfried Aigner (Institut für musikpädagogische Forschung Musikdidaktik und Elementares Musizieren), Nora Konomi (Schülerin des BG/BRG 3 Boerhaavegasse), Niklas Michlmayr (Schüler des GRG 1 Stubenbastei), Jörg Neumayer (Abgeordneter zum Wiener Landtag), und Constanze Wimmer (Anton Bruckner Privatuniversität, Plattform Musikvermittlung Österreich).
„Wie lange wird schon Musik gehört?“, fragte Michael Huber eingangs und gab sich die Antwort darauf gleich selbst: „Auf jeden Fall länger, als der Mensch spricht.“ Insofern stellt die Beschäftigung mit der Materie eine der wohl ältesten der Menschheitsgeschichte dar.
In Tradition des Instituts für Musiksoziologie und dessen unvergessener Koryphäe Kurt Blaukopf gehe es, so Huber, immer um einen hohen Grad an Praxisrelevanz. Blaukopf habe einmal gesagt, jede Forschung habe neben der Relevanz für den universitären Bereich auch eine für künftige kulturpolitische Entscheidungen aufzuweisen. Ein hehrer Anspruch, dem man auch bei diesem Thema gerecht werden wolle.
Was folgte, war eine einleitende „Tour de Force“ durch die Ergebnisse der beiden Pionierstudien zum Musikrezeptionsverhalten der ÖsterreicherInnen aus den Jahren 2010 und 2015 unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen, die sich diesbezüglich durch die Digitalisierung ergeben haben. Heute, so Huber, gelinge es mühelos, Musik eigentlich ständig mit sich herumzutragen. Daraus ergebe sich eine Überflusssituation: Musik sei jederzeit und überall konsumierbar und man sei eigentlich gar nicht mehr imstande, das adäquat zu rezipieren.
Insgesamt seien, das zeige jede Statistik, die aus Musik erzielten Umsätze drastisch zurückgegangen. Streaming habe diese Umsatzeinbußen nur unzureichend kompensieren können, wobei hier die österreichische Situation im Vergleich zur internationalen als positiv zu bewerten ist. Das bedeute, dass sich die internationale Situation weitaus trister darstellt als die österreichische. Gleichzeitig seien aber die Umsätze eines Konzerns wie Apple geradezu explodiert, wobei sich der Umsatzgewinn nicht aus dem Geschäft mit der Musik an sich ergebe, sondern aus dem Handel mit Lifestyleprodukten wie iPod, iPhone und dergleichen, die allesamt in Zusammenhang mit Musik angeboten werden.
In Österreich seien, so Huber in seinem Überblick, die AKM-Einnahmen seit 1998 leicht gestiegen, das zeige die Statistik. Etwa gleichzeitig mit dem Auftauchen von Streaming als signifikanter Größe der Umsatzgenerierung sei auch der Vinylabsatz gestiegen, was laut Huber die Vermutung nähre, dass Vinyl als eine Art Gegenentwurf bzw. Substitut zur Streamingkultur gepflegt wird.
Als Beispiel dafür, wie das Web 2.0 die Hörgewohnheiten vor allem junger Musikkonsumentinnen und -konsumenten beeinflusst, könne die Plattform musical.ly angesehen werden. Da gehe es nur noch untergeordnet um Musik. Im Mittelpunkt stünden vielmehr die Interaktion und die Verbindung durch Konsum bzw. die Darstellung der eigenen Kreativität vor dem Hintergrund fremder Musik, indem sich Teenager beim Playback ihrer Lieblingssongs filmen und diese Snippets dann ins Netz stellen. Einer der „Stars“ dieser Plattform, Ariel Martin, bringe es immerhin auf bis zu 15 Millionen Zugriffe auf ihre Videos. Das bedeutet, dass ihr 15 Millionen dabei zusehen, wie sie einen ihrer Lieblingssongs beim Zähneputzen oder dergleichen intoniert.
In seiner Darstellung näherte sich Huber daraufhin jenem Kapitel im Buch, das thematisch auch die folgende Podiumsdiskussion vorwegnimmt, der untersuchten Frage nämlich, ob sich geänderte Verhaltensweisen im Musikkonsum der Generation Web 2.0 festmachen lassen und wenn ja, ob es sich dabei nur um vorübergehende Trends oder längerfristig relevante Konsumverhalten handelt. Insgesamt an die 1.200 ÖsterreicherInnen wurden für die Studie befragt. Signifikante Ergebnisse sind:
- Etwa drei Viertel der unter 25-jährigen sagen, dass Musikhören unterwegs für sie wichtig ist. Der Konsum von Musik hat also bei der jungen Zielgruppe sehr viel mit Mobilität zu tun.
- Der weitaus überwiegende Teil der Jugendlichen sagt, Musik bereichere ihr Leben. Die Bereitschaft, für Musik Geld auszugeben, ist demgegenüber allerdings gering.
- Als Quellen geben Jugendliche in dieser Reihenfolge Freunde, Radio und TV an. Erst dann, d. h. also an vierter Stelle, wird das Internet genannt. Als Tool hat jedoch das Smartphone längst das Radio abgelöst. Das Interessante daran: 2010 und damit vor noch nicht allzu langer Zeit rangierte das Smartphone noch an letzter Stelle der Abspieltools. Das rühre daher, so Huber, dass das Smartphone aufgrund des hohen Anschaffungspreises damals noch ein für die breite Masse nicht erschwingliches Luxusgut war. Das habe sich seitdem grundlegend geändert. Da Smartphone sei längst in der Breite der Bevölkerung angekommen; beinahe jede und jeder verfüge über eines.
- Interessant ist laut Huber auch die häufige Nennung von Second-Screen-Aktivitäten, d. h. also einer zweiten oder sogar bildschirmgebundenen Tätigkeit, die neben dem Musikhören ausgeübt wird. Musik wird demnach nur noch selten allein und mit ausschließlicher Aufmerksamkeit wahrgenommen. Nur wenige Jugendliche konzentrieren sich beim Musikhören ausschließlich auf die musikalische Quelle.
- Ein weiterer interessanter Punkt ist auch der mit dem Smartphone als dominierendem Abspielgerät einhergehende Kontrollverlust der Eltern. Während früher die Eltern auf Abspielgeräten in der Wohnung quasi immer laut und deutlich wahrnehmen konnten, welche Musik ihre Kinder gerade hören, ist das laut Studie aufgrund der Mobilität der Abspielgeräte, aber auch aufgrund des überwiegenden Hörens mit Kopfhörern heute nicht mehr der Fall.
Abschließend machte Huber noch auf die wohlbekannte Diskrepanz zwischen der in zahlreichen Studien, allen voran in der populären Studie von Anne Bamford („The Wow Factor“) belegten Wichtigkeit von Musik für die juvenile Entwicklung und dem Umstand, dass gleichzeitig die musikalische Ausbildung innerhalb unseres Systems gerade radikal zurückgefahren wird, aufmerksam. Vielmehr versuche die Kulturpolitik die Klischees der Fremdenverkehrswerbung zu bedienen, indem sie sich zum weitaus überwiegenden Teil auf die Bedienung der klassischen Schiene konzentriere und nur etwa zwei Prozent der Ausgaben des Bundes für die Bereiche Jazz, Pop und World bereitstelle. Daraus ergebe sich die Frage, inwiefern Kulturpolitik überhaupt die geänderten Rahmenbedingungen wahrnimmt und inwiefern sie darüber hinaus die junge Zielgruppe im Auge hat.
Vor allem die Sichtweisen der beiden an der anschließenden Diskussion beteiligten Jugendlichen waren, wenn sie auch oft konträr waren, erhellend. Nora Konomi etwa behauptete von sich, eigentlich ständig in ihrem Leben von Musik umgeben zu sein. Sie spiele viermal wöchentlich Klavier, Musik aber höre sie überwiegend mit dem Handy. Sie kaufe auch Musik, aber nur jene von Leuten, d. h. Komponistinnen und Komponisten oder Interpretinnen und Interpreten, die ihr auch wichtig seien. Sie treffe also eine genaue Entscheidung, welche Musik für sie wichtig und daher käuflich zu erwerben ist und welche nicht so wichtig und daher nur zu streamen ist. Es sei ihr wichtig, dass man als Musikkonsumentin bzw. Musikkonsument auch einen gewissen Obolus entrichtet. Ob sie typisch für ihre Generation sei, wollte Huber wissen. Konomi selbst zog das in Zweifel. Viele ihrer Freunde hätten Spotify und Apple. Viele würden überhaupt illegal runterladen.
Niklas Michlmayr betonte, wie wichtig das Musikhören innerhalb der Gruppe sei. Der Musikkonsum erfolge bevorzugt über das Handy, bestätigte er. Das sei deshalb so, weil man die Musik ständig bei sich haben wolle. Und als Schüler habe man einfach auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich eine große Tonträgersammlung zuzulegen. Er selbst besitze nur drei Tonträger.
Im Folgenden wurde darüber diskutiert, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Konsum von Musik gibt. Michlmayr bejahte das und meinte, Mädchen seines Alters würden Musik vor allem als Statussymbol benutzen. Konomi wiederum trat dieser Auffassung entschieden entgegen und meinte, es sei genau umgekehrt: Jungen würden sich damit brüsten, die Musik diverser Bands zu hören oder nicht zu hören, um ihren Coolness-Faktor damit zu untermauern. Festhalten lässt sich, dass es diesbezüglich offenbar Vorurteile dem anderen Geschlecht gegenüber gibt.
Musical.ly jedenfalls werde zu etwa 80 Prozent von weiblichen Usern benutzt, gab Huber zu bedenken. Der Star-Faktor sei diesbezüglich nicht unerheblich, meinte Michlmayr. Das wiederum bestätigte Konomi.
Wilfried Aigner meinte, es sei kein Wunder, dass die Elterngeneration mit der neuen Situation so überfordert ist. Das sei einfach der rasanten Geschwindigkeit geschuldet, mit der sich die Rahmenbedingungen innerhalb der letzten Jahre verändert haben. Die Konsequenz dieser anhaltenden Überforderung sei es, dass man es der Industrie überlässt und die Musikpädagogik nicht bzw. viel zu wenig in die Pflicht nimmt.
Gestaltungsspielräume aufmachen
Constanze Wimmer erklärte daraufhin ihren Ansatz: In der Vermittlung, die ja älter als der Begriff sei, denn es habe immer schon Leute gegeben, die sich und ihre Musik erklärten, beredte Dirigenten etwa, gehe es vor allem darum, Gestaltungsspielräume aufzumachen. Je prekärer die Situation in den Konzertsälen letztlich sei, desto dringender werde der Bedarf an Vermittlung wahrgenommen. Allerdings fehle hier der wirkliche Vergleich. Niemand könne schließlich ernsthaft behaupten, er wisse über den Altersschnitt in den Konzertsälen vor hundert Jahren Bescheid. Dazu gebe es keine Zahlen, sondern allenfalls Vermutungen. Derzeit sei jedenfalls ein starker Überhang zugunsten der Generation 40 plus feststellbar –mit einer leichten Schlagseite zugunsten der Generation 50 plus, so Wimmer. Das Rezept der erfolgreichen Vermittlung sei einfach: Information und Kooperation. Dafür seien allerdings Ressourcen notwendig. Wenn in der neuen Elbphilharmonie ganze neunzehn Menschen mit der Vermittlung von Musik beschäftigt sind, davon einige wirkliche Spezialistinnen und Spezialisten, sei das einzigartig. Das Gros der Vermittlerinnen und Vermittler, so Wimmer, sei bei Weitem nicht so expertisefest wie in diesem konkreten Fall.
Huber wandte sich wieder an die Jugendlichen. Ob er denn etwas von Musikvermittlung mitbekommen habe, fragt er Michlmayr. Dieser verneint.
Rezeptionsfähigkeit fördern
Jörg Neumayer behauptete sodann, es bestehe leider immer noch ein hochschwelliger Zugang zur Kultur. Deshalb seien auch Initiativen wie jene in Meidling, die Kinder zu Geigen- und Bogenbauern führt, um ihnen Instrumente und ihre Entstehung näherzubringen, so wichtig. Angesichts der Fülle an Möglichkeiten sei nicht nur die Darbietung verschiedener Genres, sondern auch die Steigerung der Rezeptionsfähigkeit notwendig. Es gehe doch schon lange nicht mehr darum, alles sichtbar zu machen. Dafür sei es zu komplex geworden. Deshalb erfordere es eines enormen Grades an Selbstbestimmung, die es in den Vordergrund zu rücken gelte.
Mit der Vielfalt produktiv umgehen
Aigner hielt fest, dass es auch eine große Kluft zwischen dem Bildungsauftrag und dem Wunsch gibt, Ergebnisse zu erzielen, die auch abseits der Schule Erfolg haben. Die Aufgabe der Pädagogik sei es, hier Orientierungshilfen zu geben. „Man muss mit der Vielfalt produktiv umgehen.“
Wimmer zufolge geht es letztlich darum, anhand eines Stückes ein Aushandeln von Bedeutung herzustellen, d. h., nicht eine Bedeutung zu konstatieren, die die Schülerin oder der Schüler hinzunehmen hat, sondern gemeinsam herauszufinden, welche Bedeutung ein bestimmtes Musikstück hat. Dafür sei Interaktion bekanntermaßen wichtig.
Vermittlerinnen und Vermittler seien Experten in Sachen Musik, die Jugendlichen in Sachen Medien. Diese Kompetenzen gelte es zu vereinen bzw. auf Augenhöhe zu verhandeln, so der abschließende Tenor.
Dem Faktum, dass immer mehr Jugendliche den Musikunterricht abwählen, sobald sie diese Entscheidung selbstständig treffen können, d. h. zwischen bildnerischer und musikalischer Erziehung wählen können, hielt Neumayer entgegen, dass man Berührungspunkte möglich machen müssen, auch in den Nischen.
Es geht wohl auch darum, Musik auf eine Weise erfahrbar zu machen, die Jugendliche überhaupt noch anspricht, denn die ehrliche Aussage Michlmayrs, er wisse in Sachen Musik zwar viel, dieses Wissen berühre ihn aber nicht, wirkt nach. Letztlich gehe es – und darin hat sich dann wohl in den letzten Jahrzehnten doch nicht so viel geändert – darum, eine Bedeutung herzustellen bzw. diese so zu vermitteln, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, selbst die Wichtigkeit eines bestimmten Themas zu erkennen.
Markus Deisenberger
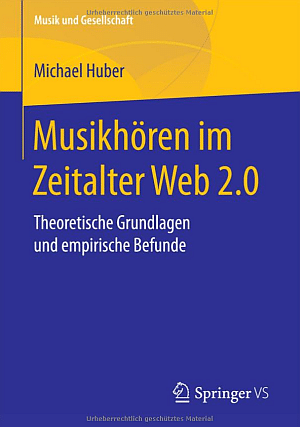 Michael Huber, 2017, Musikhören im Zeitalter Web 2.0. Theoretische Grundlagen und empirische Befunde. Wiesbaden, Springer VS, ISBN 978-3-658-19199-3, EUR 25,69 (Softcover)
Michael Huber, 2017, Musikhören im Zeitalter Web 2.0. Theoretische Grundlagen und empirische Befunde. Wiesbaden, Springer VS, ISBN 978-3-658-19199-3, EUR 25,69 (Softcover)

